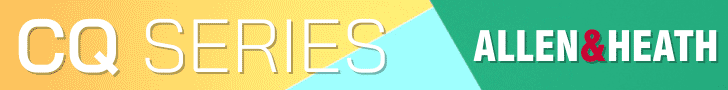Obwohl Streaming den Kampf um die Gunst der Konsumenten gewonnen hat, wächst die Nachfrage nach Tonträgern weiterhin seit vielen Jahren. Während sich Schallplattensammler im siebten Himmelf wähnen, wollen andere mehr: Ist die Zeit reif für das ultimative physische Audioformat.
von Tobias Fischer
Vor etwas über einem Jahr schickt mir ein Bekannter, der ein audiophiles Jazz-Label führt, eine Sonderausgabe eines Albums. Zunächst hielt ich es für eine reguläre Cassette in einem Pappschuber. Sobald ich aber das vermeintliche Tape entnommen hatte, entdeckte ich, dass es sich lediglich um eine Art Booklet handelte, auf dessen Rückseite eine dünne „Platine” aufgetragen war. Sobald ich diese gegen mein Handy hielt, wurde ich auf einen Player mit der Musik weitergeleitet. Das „Tap Tape” – so genannt, weil man auf seine Inhalte durch das „Tippen” des Mediums gegen ein Mobilgerät zugreift – verbindet die Haptik traditioneller Tapes mit der Tragbarkeit tonträgerlosen Streamings. [1] Entwickelt wurde es von Peter Rullmann aus Homburg, der vor seinem Abenteuer in der Musik die selbe Technologie für Glückwunschkarten nutzte. Das Konzept ist unbestreitbar clever – achteinhalb Tausend Kilometer entfernt hatte indes jemand die praktisch identische Idee.
Das südkoreanische „KIT” ist optisch der MiniDisc nicht ganz unähnlich, aber ebenfalls als inhaltsloses Inhaltsmedium konzipiert, das erst durch das Herstellen einer Verbindung mit der zugehörigen App auf dem SmartPhone die auf dem KIT-Server hinterlegten Inhalte aufschließt. [2] Das Konzept kann in einer Vielzahl verschiedener Verpackungen erworben werden und mutet durchaus edel an: Das legendäre britische Metal-Label Earache beispielsweise hat einige seiner bekanntesten Alben als KIT-Editionen neu herausgebracht. Die eleganten Module für Klassiker wie Morbid Angels „Altars of Madness” liegen nun, zusammen mit Fotokärtchen, neuen Liner Notes und verspielten Paraphernalia, in einer kleinen Metallschachtel. Genial oder Gimmick? Die Death-Metal-Gemeinde reagierte vor allem mit Verachtung, doch vor allem dank seiner Beliebtheit im K-Pop-Bereich, wurden weltweit angeblich schon neun Millionen KIT-Alben verkauft. [3]
Grundlegend seltsam
De Erfolg sei ihnen gegönnt, vor allem, weil beide Fomate in Sachen Produktion und Vertrieb durchaus attraktive Konditionen für MusikerInnen bieten. Doch sind vor allem KITs grundlegend seltsam. Zwar wäre es denkbar, mit ihnen exklusives Bonus-Material zu hinterlegen, doch scheinen nur wenige Labels an diesem Feature interessiert zu sein. Um an die Musik zu gelangen, ist immer noch eine Internetverbindung erforderlich und sollten die Hersteller ihre Dienste einmal einstellen, bleibt nichts außer einer Hülle, verkommt das Produkt zu einem stillen Artefakt, einer grußlosen Grußkarte. KIT fügt diesen Einschränkungen sogar noch ganz bewusst eine weitere hinzu: Zu jedem gegebenen Zeitpunkt lässt sich nur ein einziges Album in den Player laden und es bleibt dort auch nur 24 Stunden lang hörbar, bevor es erneut aktiviert werden muss. Man könnte auch sagen: Auf eine zugegebenermaßen sehr ansprechende Weise verbindet das Format die Nachteile beider Welten.
Dass diese Objekte überhaupt existieren mutet somit recht paradox an, wird aber schlüssig, wenn man sie, genau wie Vinyl, Tapes und CDs, als eine Art Gegengewicht betrachtet, welche den explosiven Aufstieg virtueller Technologien „erdet”. Oder anders gesagt: Um so dominanter Spotify und Apple werden, um so mehr wächst auch das Bedürfnis danach, etwas in den Händen halten zu können, das Sicherheit, Langlebigkeit und eine persönliche Beziehung mit Musik und KünstlerInnen repräsentiert. Gerade ihre Limitierungen verdeutlichen, was der emotionale Hintergrund für diese neuen Formate ist. Der niemals um ansprechende Zitate verlegene Earche-Boss Tim Bailey erklärt sein Interesse an KIT folgendermaßen: „Die Welt der digitalen Musik kann überwältigend sein. Ich vertiefe mich nur noch selten in Alben so, wie ich es früher getan habe. (…) Das bedeutet, dass ich nicht mehr die gleiche intensive Verbindung zu meiner neuen Lieblingsmusik habe, wie ich sie früher hatte. Das KiT-Album lädt uns ein, tiefer zu gehen. (…) Durch das Verbinden des KiT-Albums mit der App wird eine zusätzliche Ebene der Intentionalität in das Hörerlebnis eingebracht: Man muss sich genauso darauf einlassen, wie früher, wenn man eine Kassette in einen Walkman oder eine CD in einen Discman eingelegt hat.” [4]
Böse Zungen sehen darin wenig mehr als einen netten Versuch, noch mehr Kopien der immerselben Earache-Klassiker unters Volk zu bringen. Tatsache ist aber.
Immer mehr Hörer empfinden eine tiefe Unzufriedenheit über die Auswirkungen des Streamings
Einerseits erlaubt einem maximale Mobilität, Musik wortwörtlich zum Soundtrack des eigenen Lebens zu machen. Andererseits sind Algorithmen darauf getrimmt, Muster zu erkennen und zu bestätigen – glückliche Zufälle und die Art von über-den-Tellerrand-hinausgehenden Überraschungen, die einen im Plattenladen oder beim Durchwühlen der Plattenkiste oder CD-Sammlung bei Freunden regelmäßig ereilen, sind hier eher Seltenheit. Und noch ein Punkt ist nicht zu unterschätzen: In einer nahezu dauerhaft im Online-Modus gefangenen Welt, können andere die eigene Playlist einsehen. Auch ich wurde bereits einmal darauf angesprochen, warum ich mir in letzter Zeit so viel Mariah Carey angehört habe. So kann die Wahl des nächsten Titels zu einer stressvollen Angelegenheit werden: Wenn die Musik, für die man sich entscheidet, die persönliche Gefühlswelt widerspiegelt, will man nicht unbedingt, dass die ganze Welt dabei zuhört. [5]
Und so findet eine Gegenbewegung statt, die sich dem Diktat der Algorithmen und Statistiken widersetzt und auf eine intimere Interaktion mit Musik setzt. Manche Artists ziehen ihre Alben von Spotify und Co ab, setzen stattdessen auf den Verkauf von CDs und LPs auf Konzerten. Sogar der vermeintlich tote Download erlebt als Einkommenquelle ein bemerkenswertes Comeback. Interessant ist dabei, dass viele Anhänger dieser Bewegung gar nicht auf traditionelle Medien setzen, sondern vielmehr auf randvoll gefüllte SD-Karten für ihr Handy oder innovative Server-Lösungen. Navidrome [6] oder Symfonium [7] sind Beispiele für Lösungen, die dem „Big Streaming” ein „Personal Streaming” entgegensetzen. Die Software indexiert sämtliche Musik auf einer Festplatte und macht sie über eine App auf dem mobilen Endgerät des/r AnwenderIn verfügbar.
Diese Entwicklungen zeigen recht deutlich auf, dass Streaming und digitale Formate, wenn man den Begriff weiter fasst, keineswegs die Liebe zur Kunst töten oder in sozialer Isolation enden müssen. Eher im Gegenteil. Ich habe ganze Abende mit Freunden damit verbracht, uns gegenseitig auf Yutube Songs vorzuspielen und über Musik zu reden – was ganz gewiss mit CDs oder LPs nicht möglich gewesen wäre. Gerade Downloads sind das beste Format schlechthin, um KünstlerInnen direkt zu unterstützen, weil sie ohne die Investitionen und langen Vorlaufzeiten, die beispielsweise bei einer LP-Produktion anfallen, auskommen. Genauso trifft zwar Tim Baileys Feststellung zu, dass Streaming ständiges Springen und damit eher lockere Bindungen mit einer Veröffentlichung begünstigt. Wahr ist aber auch, dass das Gefühl, von dem Angebot überwältigt zu werden, oftmals dazu führt, dass man immer wieder die selben Inhalte streamt – was verblüffenderweise zu einer ganz besonders engen Bindung mit bestimmten Titeln führt.
Maximale Körperlichkeit
Alleine schon deswegen ist der Vorschlag des Muskkritikers Ted Goia für ein Super-Vinyl, auf dem auch digitale Medieninhalte wie Videos gespeichert werden können (er bezeichnet es als „Vinyl auf Anabolika”) eher unrealistisch – nichts davon ließe sich nicht genauso über Streaming mit entsprechenden Endgeräten umsetzen. [8] Überhaupt kommen immer mehr Kreative zu dem recht überzeugenden Schluss dass es, wie Joe Clay von dem Label GODDEZZ es formuliert, im Grunde genommen nicht drauf ankommt, was man verkaufe, „solange es etwas ist, das du anfassen kannst”. Und so stellen manche Schallplattenbeschwerer her, verpacken ihre Alben in eigens entworfenen Pizzaschachteln oder drucken holografisches Vinyl oder Picture-LPs, die in den aktuellen Trend passen, Vinyl lieber an die Wand zu hängen als anzuhören. [9] Was Goia, dessen Ausführungen zu dem Thema dennoch sehr spannend und lesenswert sind, scheinbar nicht versteht ist, dass Vinyl und CDs nicht mit Streaming konkurrieren. Sie bieten vielmehr etwas, was sich nicht mit Parametern wie Innovation, Klangqualität oder Komfort erfassen lässt. Ob der Weg in die Zukunft in der Einführung künstlicher Beschränkungen wie bei KIT liegt, darf hingegen ebenso bezweifelt werden.
Man muss das Rad aber glücklicherweise nicht neu erfinden. Physische Produkte stellen eine Manifestation einer inneren Verbundenheit dar, die nach einem Ventil sucht und die gute alte CD bleibt ein hervorragendes und kostengünstiges Format, dem Ausdruck zu verleihen – genau wie traditionelles Merchandising. Das Label Transcending Obscurity ist ein großartiges Beispiel. Aus Indien veröffentlicht man extremen Death- und Black-Metal auf CD oder LP in allen möglichen Farben und Varianten und bietet bedruckte TShirts, Jacken und Kaffeetassen an, die dank sehr fairer Preise und eines weltweiten Distributionsnetztes in der Regel sehr rasch ausverkauft sind. [10] Totgesagte leben nicht nur länger. Sie bleiben oftmals bis ins hohe Alter quicklebendig.
[1] https://tap-tape.com/ [2] https://www.kitbetter.com/en [3] https://www.musicweek.com/labels/read/earache-partners-with-korean-music-tech-company-muzlive-on-hybrid-kit-format/091619 [4] https://earache.com/collections/morbid-angel/products/morbid-angel-altars-of-madness-kit-album-pre-order [5] https://theconversation.com/i-almost-feel-like-stuck-in-a-rut-how-streaming-services-changed-the-way-we-listen-to-music-219967 [6] https://www.navidrome.org/ [8] https://www.honest-broker.com/p/the-case-for-super-vinyl [9] https://djmag.com/features/got-be-real-changing-face-physical-music-releases [10] https://tometal.com/